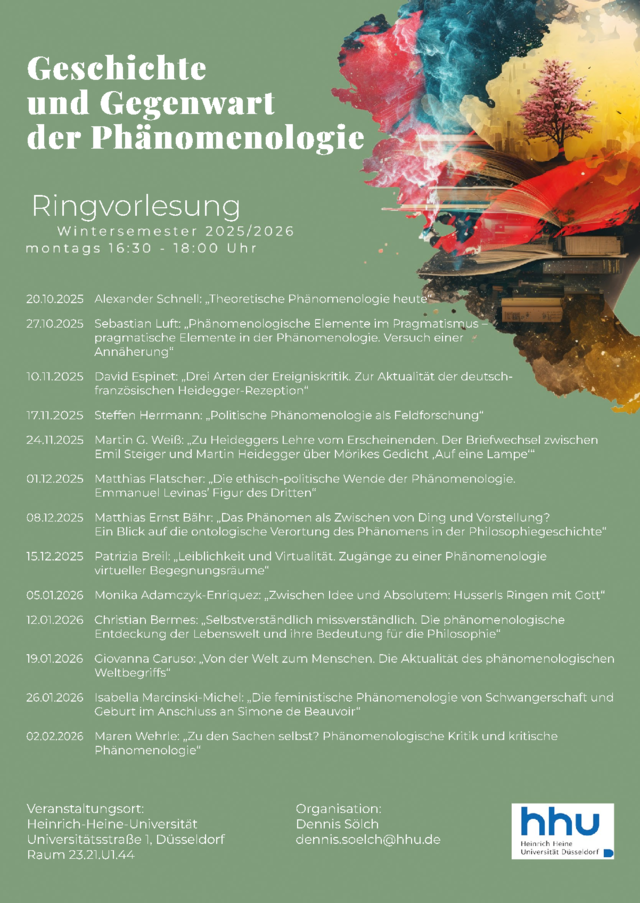In den letzten fünf bis sechs Jahrzehnten hat die Phänomenologie – vor allem dank entscheidender Impulse aus dem französischsprachigen Raum – eine Dezentrierung erfahren und ihr Koordinatensystem grundlegend geändert. Spätestens seit ihrer dritten Generation lässt sie sich nicht mehr als eine Egologie (Husserl) und auch nicht mehr als eine Analytik des Daseins (Heidegger) auffassen. Jeglichem subjektiven „Grund“ wurde eine Absage erteilt. – Das gilt im gleichen Maße für alle maßgeblichen Vertreterinnen und Vertreter der Phänomenologie seit 1960. – Auch wenn sich Patočkas bedeutsames Schlagwort einer „asubjektiven“ Phänomenologie vielleicht (noch) nicht allgemein durchgesetzt hat, ist deutlich geworden, dass die Phänomenologie sich auf eine maßgebliche Weise den nicht antizipierbaren „Ereignissen“ und den anonymen „Sinnbildungsprozessen“ zugewandt hat (Gondek; Tengelyi, Neue Phänomenologie in Frankreich, 2011), sodass sie sich gegen vielfältige, zumeist von außen an sie herangetragene Vorwürfe – des Subjektivismus, Solipsismus, Produktionsidealismus usw. – immun gemacht hat.
Ziel dieses Beitrags ist es, die grundlegenden Bestimmungen jener „neuen Phänomenologie“ herauszuarbeiten. Dies umfasst sowohl die maßgeblichen Vertreter – insbesondere den jungen, bislang oftmals nicht hinreichend gewürdigten Derrida sowie Richir – als auch die zentralen Begriffe wie etwa „Präphänomenalität“ oder „transzendentale Matrize“, durch welche die Phänomenologie in methodischer wie in sachlicher Hinsicht auf neue Wege geführt worden ist. Im Mittelpunkt steht das Anliegen, die Grundlagen für eine erneuerte theoretische Phänomenologie zu entwickeln.
Alexander Schnell hat zwei Jahrzehnte an französischen Universitäten gelehrt und geforscht (Paris 12, Poitiers, Paris-Sorbonne). Seit 2016 ist er Professor für theoretische Philosophie und Phänomenologie an der Bergischen Universität Wuppertal. Er leitet dort das Institut für Transzendentalphilosophie und Phänomenologie (ITP). Er ist Präsident der Association internationale de phénoménologie. Seine Forschungsschwerpunkte sind die Klassische Deutsche Philosophie, die gesamte phänomenologische Tradition sowie die französische Philosophie des 20. und 21. Jahrhunderts. Er hat 30 Monographien und zahlreiche Sammelbände veröffentlicht. Auswahl: Deleuze und die Phänomenologie (Klostermann, im Druck), Die Entdeckung der Präphänomenalität. Vorlesungen zur theoretischen Phänomenologie (Klostermann, 2025), Realität im Spiegel der Zeit. Die Philosophie von Black Mirror (Klostermann/Nexus, 2024), Zeit, Einbildung, Ich. Phänomenologische Interpretation von Kants „Kategorien-Deduktion“ (Klostermann, 2022), Der frühe Derrida und die Phänomenologie (Klostermann, 2021), Seinsschwingungen (Mohr Siebeck, 2020) und Wirklichkeitsbilder (Mohr Siebeck, 2015).